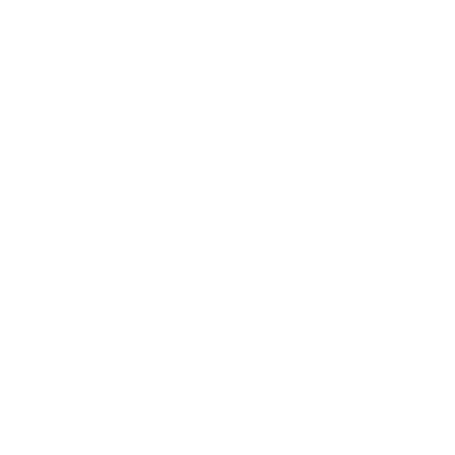27
JUN
2025
SPD im freien Fall: Bas mit Glanz – Klingbeil wird abgestraft
Was sich heute auf dem Bundesparteitag der SPD in Berlin abspielte, ist weit mehr als ein Personalwechsel an der Spitze: Es ist der Offenbarungseid einer Partei, die ihre Orientierung, ihre Glaubwürdigkeit – und zunehmend auch ihre Basis – verliert. Während Bärbel Bas mit einem traumhaften Ergebnis von 95 % zur neuen Co-Vorsitzenden gewählt wurde, erlitt Lars Klingbeil, Bundesfinanzminister und Vizekanzler, eine demütigende Schlappe: Nur 64,9 % der Delegierten votierten für ihn. Für einen amtierenden Parteichef ein nahezu desaströses Ergebnis – und eine schallende Ohrfeige.
Was für Klingbeil als Bestätigung gedacht war, geriet zum Debakel. Noch vor wenigen Jahren galt er als Hoffnungsträger, als Brückenbauer zwischen Partei und Regierung. Heute wirkt er wie ein Symbol für das selbstzufriedene Machtkartell an der Spitze der SPD – abgehoben, uneinsichtig, von innerer Dynamik und programmatischer Klarheit weit entfernt. Die Delegierten haben ihn dafür abgestraft – in aller Deutlichkeit. Die Quittung ist kein Betriebsunfall, sondern die Folge jahrelanger strategischer Fehlentscheidungen und eines zunehmend autokratischen Führungsstils.
Der Kontrast zur Wahl von Bärbel Bas könnte kaum größer sein. Die ehemalige Bundestagspräsidentin und heutige Sozialministerin wurde mit überwältigender Mehrheit gewählt – nicht nur aus Respekt vor ihrer Person, sondern vor allem aus Verzweiflung über den Zustand der Partei. Ihre Nominierung wirkt wie ein letzter Rettungsanker, ein Versuch, die Partei aus dem Morast parteiinterner Machtkämpfe zu ziehen.
Denn dieser Parteitag war kein Neuanfang – er war ein Schauplatz offener Reibung. Die Parteiflügel liegen im offenen Streit, die Stimmung unter den Delegierten schwankte zwischen Resignation und unterschwelliger Wut. Der Rückzug von Saskia Esken war nicht etwa Ergebnis eines fairen Wettbewerbs, sondern Folge massiver innerparteilicher Intrigen. Dass die Verantwortlichen für die schlechtesten Wahlergebnisse der Parteigeschichte nun auch noch an ihren Posten festkleben, ist an Zynismus kaum zu überbieten.
Besonders entlarvend ist der Blick auf Berlin, wo die Parteilinke nicht davor zurückschreckte, den ehemaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin und Landeschef zu demontieren – ein weiterer Beleg für die erbarmungslose Selbstzerfleischung einer Partei, die sich selbst zur dauerhaften Opposition formt. Was in den Landesverbänden passiert, setzt sich im Bund fort: Misstrauen, Machtgier, Machterhalt um jeden Preis.
Klingbeil sprach nach seiner Wahl von Verantwortung und Geschlossenheit. Doch wer mit weniger als zwei Dritteln der Stimmen gewählt wird, hat weder Rückhalt noch Führungsautorität. Seine Position ist geschwächt, seine Legitimität angekratzt. Die SPD steht nicht am Anfang einer Erneuerung, sondern am Rand eines Abgrunds, den sie sich selbst gegraben hat.
Persönliche Bewertung
Die SPD schafft sich selbst ab – Stück für Stück, auf offener Bühne. Nach den desaströsen Landesparteitagen, etwa in Berlin, wo die Parteilinken ihren ehemaligen Regierenden Bürgermeister und Landesvorsitzenden kaltgestellt haben, und nach einem historischen Wahldesaster im Bund, klammern sich ausgerechnet jene, die für den Niedergang verantwortlich sind, an die Macht. Saskia Esken wurde geopfert, nicht ersetzt. Die SPD-Führung demonstriert: Es geht nicht mehr um Inhalte – es geht um Posten. Für einen echten Neuanfang braucht es radikalen Schnitt und komplett neue Gesichter. Hoffentlich gelingt es Bärbel Bas, dieser taumelnden Partei wenigstens eine politische Restwürde zu erhalten.
– Kommentar von Jannik Rubeck

Bild: KI - Open AI
25
JUN
2025
Berliner Verfassungsgerichtshof erklärt Volksentscheid „Berlin autofrei“ für zulässig
Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin hat den Weg für das Volksbegehren „Berlin autofrei“ freigemacht. In einem richtungsweisenden Beschluss erklärte das höchste Berliner Gericht das geplante Volksbegehren für verfassungsrechtlich zulässig. Damit kann die Initiative nun die zweite Stufe des Verfahrens einleiten und endlich mit der Sammlung von rund 170.000 Unterschriften beginnen.
Gericht bestätigt demokratische Beteiligung
Der Verfassungsgerichtshof teilte in einer Pressemitteilung mit, dass das Volksbegehren zulässig sei, da es sich inhaltlich im Rahmen der Berliner Verfassung bewege. Der Entwurf verfolge ein „legitimes Gemeinwohlziel“, insbesondere durch die Förderung von Umwelt- und Klimaschutz sowie der Verkehrssicherheit. Die vorgeschlagenen Regelungen zur Reduzierung des Autoverkehrs innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings stellten nach Ansicht des Gerichts keinen unverhältnismäßigen Eingriff in Grundrechte dar.
„Ein Anspruch auf die uneingeschränkte Nutzung des öffentlichen Straßenraums mit privaten Kraftfahrzeugen besteht nicht“, heißt es in der Mitteilung des Verfassungsgerichtshofs. Das Gericht stellte außerdem klar, dass das Eigentumsrecht am Auto durch die Regelungen nicht angetastet werde – lediglich die Nutzung im innerstädtischen Bereich solle beschränkt werden.
Acht der neun Verfassungsrichterinnen und -richter stimmten für die Zulässigkeit, eine Richterin äußerte abweichende Auffassung.
Entwurf sieht drastische Reduktion des Autoverkehrs vor
Die Initiative „Berlin autofrei“ will den motorisierten Individualverkehr im innerstädtischen Bereich massiv einschränken. Laut Entwurf sollen die meisten Straßen innerhalb des S-Bahn-Rings künftig „autoreduziert“ genutzt werden. Jede Person dürfte maximal zwölf private Autofahrten pro Jahr durchführen. Ausnahmen sollen unter anderem für Menschen mit Behinderung, Rettungsdienste, Wirtschaftsverkehre sowie den öffentlichen Nahverkehr gelten.
Der Berliner Senat hatte 2022 Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Volksbegehrens angemeldet und das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof angestoßen. Hauptkritikpunkt war, dass das Gesetz zu stark in die allgemeine Handlungsfreiheit und das Eigentumsrecht eingreife. Diese Argumente wies das Gericht nun zurück.
Reaktionen auf das Urteil
Die Initiative zeigte sich erleichtert über den Beschluss. „Uns ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen“, erklärte Mitinitiatorin Nina Scholz. Man sei überzeugt, dass der Entwurf „nicht nur rechtlich zulässig, sondern auch politisch und gesellschaftlich dringend notwendig“ sei.
Auch Umweltorganisationen begrüßten das Urteil. So sagte Lena Donat von Greenpeace: „Die Entscheidung ist ein starkes Signal für die demokratische Mitbestimmung in der Verkehrspolitik. Es ist richtig, dass die Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft der Mobilität in ihrer Stadt mitentscheiden können.“
Der RBB berichtete, dass das Urteil insbesondere bei verkehrspolitischen Initiativen als Meilenstein gilt. Die Diskussion darüber, wie viel Raum der Autoverkehr in einer modernen Großstadt noch beanspruchen sollte, dürfte damit eine neue Dynamik erhalten.
Nächste Schritte
Die Initiative hat nun vier Monate Zeit, mindestens sieben Prozent der Berliner Wahlberechtigten zur Unterstützung zu mobilisieren. Sollte die notwendige Zahl an Unterschriften erreicht werden, könnte es im kommenden Jahr zum Volksentscheid kommen.
Der Verfassungsgerichtshof betonte zugleich, dass bei einer möglichen Umsetzung des Gesetzes eine sorgfältige Prüfung erforderlich sei – insbesondere im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Nahverkehrs und der wirtschaftlichen Infrastruktur.
Fazit: Der Berliner Verfassungsgerichtshof hat mit seiner Entscheidung ein starkes Zeichen für die direkte Demokratie gesetzt. Die Bürgerinnen und Bürger Berlins können nun in einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob die Hauptstadt künftig deutlich autofreier werden soll. Das Urteil dürfte auch über Berlin hinaus Debatten über urbane Mobilität und Klimaschutz anstoßen.

Bild: KI - Open AI/ChatGPT
21
JUN
2025
Turban im Polizeidienst - Religionsfreiheit oder Verletzung der Neutralitätspflicht?
Was der Streit um religiöse Symbole in der Polizei über Religionsfreiheit, Neutralität und gesellschaftlichen Zusammenhalt verrät
Ein Polizeianwärter mit Turban – das klingt nach Selbstverständlichkeit in einem vielfältigen, demokratischen Staat. Doch der Fall des Bremer Polizeischülers J. Singh hat gezeigt: So selbstverständlich ist das Tragen religiöser Symbole im Staatsdienst keineswegs. Vielmehr berührt dieser Fall zentrale Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens: Wie viel Sichtbarkeit religiöser Identität verträgt der öffentliche Dienst? Und wie lässt sich die staatliche Neutralität in einer multireligiösen Gesellschaft sinnvoll definieren?
J. Singh trat im April 2025 seinen Dienst bei der Polizei Bremen an – mit Turban, getragen aus religiöser Überzeugung. Die Polizei Bremen bestätigte auf Anfrage, dass es keine gesetzliche Regelung gebe, die religiöse Kopfbedeckungen generell verbietet. Das Grundrecht auf Religionsfreiheit sei zu achten – es sei denn, einsatztaktische oder sicherheitsrelevante Gründe sprächen dagegen. Dann müsse auch ein Turban abgelegt werden.
Was zunächst als interner Einzelfall behandelt wurde, entwickelte sich zu einer öffentlichen
Debatte. Inzwischen steht die Bremer Innenbehörde unter Handlungsdruck: Eine Rechtsverordnung zur Regelung des Erscheinungsbilds im Polizeidienst ist in Arbeit. Bis dahin gilt: Einzelfallprüfung – mit ungewisser Rechtslage und wachsender gesellschaftlicher Brisanz.
Verfassungsrecht und Ermessensspielräume.
Die auf das Beamtenrecht spezialisierte Anwältin Dr. Jessica Heun verweist auf mehrere Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts, die das äußere religiöse Bekenntnis im Staatsdienst ausdrücklich schützen – etwa im Schulkontext.
Allerdings habe das Bundesverfassungsgericht 2020 für den Bereich der Justiz, mit der Verpflichtung einer Amtstracht, einschränkende Regelungen für zulässig erachtet.
Für Landesbeamten erlaubt 34 Abs. 2 Beamtenstatusgesetz Einschränkungen religiös konnotierter Kleidung dann, wenn diese „objektiv geeignet“ ist, das „Vertrauen in die neutrale Amtsführung zu beeinträchtigen“. Doch was bedeutet das in der Praxis? „Ob ein Turban tatsächlich objektiv geeignet ist, das Vertrauen der Bürger:innen in eine neutrale Amtsführung zu beeinträchtigen, ist mehr als fraglich“, sagt Dr. Heun.
Staatliche Neutralität – Abwesenheit oder Gleichbehandlung?
Für Prof. Dr. Gregor Etzelmüller, Theologe an der Universität Osnabrück, ist klar:
„Neutralität bedeutet nicht das Verdrängen religiöser Identität, sondern das gleichberechtigte Nebeneinander weltanschaulicher Ausdrucksformen.“ Die Vorstellung, Beamt:innen dürften keine sichtbaren Glaubenssymbole tragen, sei mit der pluralen Gesellschaft schwer vereinbar – zumindest solange sie nicht in klassisch-hoheitlicher Funktion wie bei Richter:innen auftreten. „Dass ein religiöser Mensch als Polizist Rechte aller schützt, ist ein starkes Zeichen für unsere Demokratie“, so Etzelmüller.
Politische Reaktionen: Zwischen Vielfalt und Neutralität
Die Debatte hat inzwischen auch die Bremer Bürgerschaft erreicht. Während SPD und Linke den Fall unterschiedlich bewerten, eint sie das Bewusstsein um seine gesellschaftspolitische Tragweite.
Der innenpolitische Sprecher der Bremer Linksfraktion, Nelson Janßen, kritisiert den Umgang auf Bundesebene scharf:
„Wir als Linke sind geschockt, dass dieses Thema in der Innenministerkonferenz nur ein Randthema war. Wir haben uns klar gegen ein Verbot ausgesprochen und werden dies auch in der Bürgerschaft auf keinen Fall unterstützen. Das haben wir offen kommuniziert. Die Polizei braucht Diversität und Vielfalt – und ein Turban stört in keinem Fall die Arbeit als Polizist.“
Anders sieht das Kevin Lenkeit, innenpolitischer Sprecher der SPD in der Bremer Bürgerschaft. Im Interview mit Buten un Binnen erklärte er:
„Wir müssen da zu einer Regelung kommen, denn das politische Neutralitätsverbot gilt für alle.“
Er betont damit den Grundsatz, dass Polizist:innen im Dienst den Staat neutral repräsentieren müssten – ungeachtet religiöser Überzeugungen.
Die Polizei und das Selbstverständnis
Wie sieht die Polizei selbst den Umgang mit religiösen Symbolen? Uneinheitlich. Die Soziologin Prof. Dr. Daniela Hunold, die zur Polizei in der Migrationsgesellschaft forscht, beobachtet: „Über den Turban wird kaum gesprochen, beim Kopftuch hingegen sind die Fronten deutlich verhärteter.“ Auch innerhalb der Polizei gebe es sehr unterschiedliche Vorstellungen von Diversität. Sie warnt: Ein pauschales Verbot könne als Missachtung kultureller Identität wahrgenommen werden und Vertrauen in migrantisch geprägten
Communities untergraben. „Ein Imageschaden für die Polizei entsteht dadurch höchstwahrscheinlich nicht in der breiten Gesellschaft.“, so Hunold.
Hunold verweist zudem auf das sogenannte „Landsmann-Phänomen“: Menschen mit Migrationshintergrund erwarteten von Polizist:innen mit ähnlichem Hintergrund oft ein besonderes Verständnis oder sogar Solidarität. Auch das mache die Sichtbarkeit von Diversität im Dienst wichtig – aber zugleich komplex.
Europa: Zwischen Paris und London
International zeigt sich das Bild gespalten. In Frankreich ist das Tragen religiöser Symbole im Staatsdienst strikt untersagt. In Großbritannien hingegen gibt es seit Jahren Sikh-Polizisten mit Turban – inklusive eigens angepasster Uniformbestandteile. Deutschland bewegt sich, wie der Staatsrechtler Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Battis es formuliert, „irgendwo in der Mitte“. Der Europäische Gerichtshof hat 2023 festgestellt, dass sowohl das Verbot als auch die Zulassung religiöser Zeichen erlaubt sind – sofern sie verhältnismäßig und konsistent begründet werden.
Mehr als eine Personalie
Der Fall J. Singh ist damit mehr als ein individuelles Dilemma. Er zeigt, dass grundlegende Prinzipien wie Religionsfreiheit, Neutralität und Diversität nicht in konfliktfreier Harmonie existieren – sondern regelmäßig neu austariert werden müssen. Wie sichtbar darf Religion im Staatsdienst sein? Wo endet Gleichbehandlung, wo beginnt Identitätsverlust?
Noch ist offen, wie die Bremer Innenbehörde den Fall bewerten wird – und ob Singh seine Ausbildung fortsetzen kann. Doch schon jetzt steht fest: Der Diskurs, den sein Fall ausgelöst hat, wird die Debatte um Vielfalt und Zugehörigkeit im Staatsdienst noch lange begleiten. Vielleicht auch wegweisend für zukünftige Regelungen – nicht nur in Bremen, sondern bundesweit.

Bild: KI - Open AI
01
JUN
2025
Neuer Mutterschutz nach Fehlgeburt: Gesetz tritt in Kraft.
ten künftig Anspruch auf Mutterschutz – und damit das Recht, sich in dieser schweren Zeit zu erholen.
Bereits im Februar hatte der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt.
Initiative aus der Gesellschaft
Ausgangspunkt war eine Petition der 40-jährigen Natascha Sagorski, die sich nach eigener Betroffenheit mit großem Engagement für das Thema einsetzte. Im Gespräch mit BR24 sprach sie von einem „besonderen Tag“ für alle Frauen, die ähnliches erlebt haben.
Die neue Staffelung des Mutterschutzes im Überblick:
Ab der 13. Schwangerschaftswoche: 2 Wochen Mutterschutz
Ab der 17. Schwangerschaftswoche: 4 Wochen Mutterschutz
Ab der 20. Schwangerschaftswoche: 6 Wochen Mutterschutz
Diese neue Regelung berücksichtigt somit die zunehmende körperliche und emotionale Belastung im Verlauf einer Schwangerschaft. Für die rund 84.000 Frauen, die laut Tagesspiegel jährlich in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen eine Fehlgeburt erleiden, gilt der Anspruch allerdings nicht.
Emotionale Debatten im Bundestag
Eine der bewegendsten Reden in der Debatte hielt die SPD-Abgeordnete und Bundestagsvizepräsidentin Josephine Ortlieb (38). Sie erinnerte dabei an ihre eigene Geschichte – 2021 brachte sie ihr Kind in der 23. Schwangerschaftswoche zur Welt. „Ich hätte mir nicht vorstellen können, direkt wieder arbeiten zu müssen, wenn mein Kind verstorben wäre“, erklärte sie im Interview mit dem Regierungsradar.
Für Ortlieb ist das Gesetz ein „Meilenstein“:
> „Es war uns als SPD besonders wichtig, dass Frauen selbst entscheiden können, ob sie den Mutterschutz in Anspruch nehmen. Es geht um Selbstbestimmung.“
Gleichzeitig würdigte sie den Mut von Sagorski und kritisierte, dass betroffene Frauen bislang auf eine Krankschreibung angewiesen waren. Sie forderte eine bundesweite Aufklärungskampagne, um die neuen Regelungen bekannt zu machen.
Eine große Errungenschaft
Der renommierte Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im St. Joseph Krankenhaus Berlin Prof. Dr. Michael Abou-Dakn sprach im Interview mit dem Regierungsradar davon, dass eine Fehlgeburt nicht nur psychisch, sondern auch nachweislich körperlich je nach Fortschritt der Schwangerschaft eine große Belastung für eine Frau darstellt. Die Situation aus körperlicher und psychischer Belastung spielt aber auch schon bei frühen Schwangerschaftswochen eine große Rolle.
>„Der gestaffelte Mutterschutz ist eine Würdigung aller Frauen, diese mit Ihrem Leid nicht alleine zu lassen.“
Parteienübergreifende Zustimmung
Auch Jan van Aken (64, Die Linke) begrüßte das Gesetz ausdrücklich:
> „Eine Fehlgeburt ist ein tiefgreifendes Erlebnis – es ist richtig, dass der Staat hier schützt und unterstützt.“
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52, CDU) betonte den überparteilichen Charakter der Einigung:
> „Nach einer persönlichen Tragödie kann man von einer Frau nicht erwarten, einfach zur Tagesordnung zurückzukehren. Dieses Gesetz ist das Ergebnis echter Zusammenarbeit unter Frauen – über Parteigrenzen hinweg.“
„Ein großer Fortschritt für die Frauen in Deutschland“
Auch Ricarda Lang (31, Bündnis 90/Die Grünen), ehemalige Parteivorsitzende, zeigte sich bewegt:
> „Wer jemals eine Fehlgeburt erlebt hat, weiß um die körperliche und seelische Belastung. Am nächsten Tag wieder arbeiten zu müssen – das war ein unhaltbarer Zustand.“
Sogar aus der AfD-Fraktion kam Zustimmung. Stefan Brandner (59), AfD-Parteisprecher, erklärte:
> „Das Leid der Frauen muss heilen können. Einige mögen schnell wieder arbeiten wollen, andere brauchen Ruhe. Dieses Gesetz lässt Raum für beides – und das ist richtig.“

Bild: Deutscher Bundestag / Thomas Trutschel / photothek